Das erste Mal spreche ich mit X am Telefon. Er hat meine Nummer von jemandem, dem ich von dem Projekt erzählt habe. Er ruft an, um mir zu sagen, dass er gerne teilnehmen möchte. Wir tauschen uns kurz aus, treffen uns ein paar Tage später in einem Einkaufszentrum im Ruhrgebiet. Unser zweites Treffen ist an einem Bahnhof in einer anderen Stadt. Jetzt sitzen wir an einem heißen Tag im Schatten eines Parks, links von uns frühstückt eine Frau auf einer Bank ein Brötchen, rechts von uns dealen zwei Jungen Männer in einem Pavillon.

Ich frage X, ob es ihm leichtgefallen ist, Motive zu finden, die er fotografieren möchte. „Immer, wenn ich etwas gemacht habe, was ich auch auf Instagram gepostet hätte, hab ich’s mit der Kamera fotografiert“, sagt er lachend. Passend dazu zeigt das erste Foto, das ich zwischen uns lege, einen Tisch mit Essen und Getränken. Das war im Café Extrablatt, erzählt er mir, gemeinsam mit einer Kommilitonin. Ich frage ihn, was er studiert: Japanisch und Wirtschaft. Bereits vor seinem Abitur hat er angefangen, Japanisch zu lernen, beherrscht die Sprache mittlerweile auf B2-Niveau. „Aber ich wollte keine Japanologie machen, weil das halt sehr kulturbezogen ist und ich wollte irgendwie auch Wirtschaft machen.“ Also recherchiert er, findet seinen jetzigen Studiengang. Sein Studium beginnt er mitten in der Pandemie, das erste Semester findet komplett online statt. Ich frage ihn, wie es für ihn war, so einzusteigen. „Ja, das war schwierig. Vom Studium her war’s nicht schwierig, weil ich hab die Sachen trotzdem verstanden. Es war halt schwierig, weil ich sehr schüchtern bin und Leute nicht kennenlernen konnte, das war das Schlimmste.“ Mittlerweile – seit er in Präsenz studieren kann – hat sich seine Situation jedoch verbessert. „Das ist halt so, wenn ich irgendwie in so ne Gruppe reingesteckt werde, dann ist das kein Problem für mich, Leute kennenzulernen, aber wenn ich so in meinem Zimmer bin, allein, und es gibt keine Möglichkeit, Leute zu treffen, weil alles online ist, dann kann ich das gar nicht. Aber jetzt hat sich das zum Guten gewandelt.“ Ich frage X, ob er noch Freund:innen aus der Schulzeit hat. „Ne, gar nicht, weil ich in Tunesien zur Schule gegangen bin. Und da hab ich jetzt kein Kontakt mehr.“ Er erzählt mir, dass er nach dem Abitur nach Deutschland gekommen und zunächst ein Jahr in Tübingen zum Studienkolleg gegangen ist, um seine Zugangsberechtigung für die Universität zu erhalten. „Also kommst du auch gar nicht aus dem Ruhrgebiet?“ – „Ne.“ – „Bist du auch in Tunesien geboren?“, frage ich nach. „Ja. Aber meine Mum ist deutsch, deswegen kann ich auch Deutsch reden. Und ich hab aber den Kindergarten in Deutschland besucht und meine Schullaufbahn hab ich in Tunesien absolviert.“ Xs Mutter kommt aus einem Dorf in der Nähe der holländischen Grenze. Seine Eltern lernen sich in Tunesien kennen, leben vor seiner Geburt bereits einige Jahre zusammen in Deutschland. „Und wie war das für dich, in Tunesien aufzuwachsen?“ – „Es hatte Vor- und Nachteile. Vorteile waren: Also man lernt in Tunesien mehr Sprachen, man … – also ich weiß nicht, es ist halt nen schönes Land, so oder so. Und wenn man halt in zwei Kulturen aufwächst, find ich, dass es tatsächlich mehr Vorteile hat, wenn man in Tunesien aufwächst, als wenn man in Deutschland aufwächst. Was natürlich so ein bisschen schwierig war, ist, dass in Tunesien Homosexualität verboten ist und ich halt auf Männer stehe. Das ist halt nen bisschen schwierig gewesen.“ Ich frage, ob er sich seiner Familie gegenüber geoutet hat. „Hm, meiner Mum ja. Also mein Papa ist gestorben 2017. Und zwei Monate später – das war aber rein zufällig – hab ich’s meiner Mum erzählt. Aber in Tunesien hab ich’s sonst niemandem erzählt.“ – „Also hattest du auch nie irgendwie nen Freund oder so in Tunesien?“ – „Um Gottes Willen! Wenn man das – da kann man in Knast kommen!“ – „Also weißt du auch gar nicht, wie die Szene da lebt? Weil es gibt ja auch in Tunesien queere Menschen.“ – „Ja, die gibt’s schon. Und die leben sehr versteckt. Und nach außen hin nicht offen. Also man hat den Eindruck, dort gibt’s nur Heteros. Und da gibt’s bestimmt schwul/lesbische Menschen, die sich verstellen und heterosexuelle Ehen eingehen, weil auch einfach der Druck zu stark ist von Familie, Gesellschaft und so.“ Ich frage, ob das auch einer der Gründe war, warum er zurück nach Deutschland gegangen ist. Nein, seine Homosexualität war nicht der Hauptgrund, erklärt X, so oder so wäre er nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Auch seine Mutter ist zurück nach Deutschland gegangen, ein Jahr, nachdem er hierhingezogen ist. Geschwister hat er keine. „Also gibt’s da jetzt auch eigentlich nicht mehr so viel, was dich noch verbindet mit dem Land?“, frage ich. „Ja, leider. Mein Papa hatte Familie, aber mit denen hat sich meine Mama zerstritten.“ Nochmal zurückzugehen, kann er sich gerade nicht vorstellen. Ich frage X, wie seine Beziehung zu seinem Vater war. „Die war ganz … okay“, sagt er vorsichtig, „also … mittelmäßig“, er lacht leise. „War jetzt nicht die beste, aber ja, ging so.“
Mittlerweile lebt er seit drei Jahren in Deutschland. Ich frage ihn, ob er sich wohlfühlt hier, im Ruhrgebiet. „Also in Deutschland fühl ich mich wohl. Im Ruhrgebiet… also einerseits ja, weil ich hier sehr gute Freunde habe und Leute, mit denen ich was machen kann und so. Aber andererseits – das klingt jetzt voll rassistisch – im Ruhrgebiet gibt’s nen sehr hohen Migrationsanteil mit muslimischem Hintergrund und da ich ja in nem muslimischen Land aufgewachsen bin, weiß ich halt, wie homophob die Leute sind. Und deshalb fühl ich mich ein bisschen unwohl.“ – „Ist dir das auch schon passiert, dass du irgendwie angefeindet wurdest hier in Deutschland?“ – „Ne, das ist nicht passiert, weil ich immer meine Klappe halte“, er lacht. „Und ja, ich oute mich halt nur bei Freunden, wo ich weiß, dass es halt nicht ein Problem ist.“ Ich frage, ob X, seit er wieder in Deutschland lebt, eine Partnerschaft gehabt hat, die er auch öffentlich zeigt. „Ne, hab ich noch nicht gehabt. Aber hätte ich ein Freund, würd ich das jetzt auch nicht verstecken wollen oder so.“ – „Aber hättest du dann irgendwie Angst hier dann einfach Händchen haltend mit deinem Partner durch die Stadt zu laufen?“ – „Ja, im Ruhrgebiet würd ich das nicht machen. In Tübingen vielleicht. Ich weiß nicht, ob du Tübingen kennst, das ist so etepetete. Da würd ich’s mich eher trauen, aber hier nicht.“ Er überlegt. „Und selbst in Tübingen würd ich’s nicht zu 100 Prozent machen.“ – „Kannst du dir irgendeinen Ort vorstellen, wo das okay wäre? Wo du dich wirklich hundertprozentig wohlfühlen und nicht drüber nachdenken würdest?“ – „Ja, an nem Strand, wo kein Mensch ist.“
Wir sprechen über Xs Freundeskreis, über die Menschen in seinem Leben. „Mein Studium ist mein größter Freundeskreis. Sonst hab ich noch Freunde, die ich auf Dating-Apps kennengelernt habe, die auch schwul sind, aber mit denen bin ich nur befreundet. Hier in der Nähe sind zwei gute Freunde. Dann hab ich noch eine gute Freundin aus der Queer of Colour Group. Ja, das war’s eigentlich.“ Ich frage ihn, wie er auf die Gruppe gekommen ist. „Ich war in ner Selbsthilfegruppe für Studenten mit Depressionen. Und die hab ich mal gefragt, ob es irgendsone Gruppe gibt für queere Leute, und die hat mir dann den Kontakt davon gegeben.“ Zu der Selbsthilfegruppe geht er nicht mehr. „Das Ding ist, ich war sehr depressiv, als ich sehr einsam war wegen Corona. Und dadurch, dass sich das gelegt hat und ich wieder Leute kennenlernen konnte wegen den Lockerungen, brauch ich die jetzt auch nicht und ich hab auch jetzt ne Psychotherapeutin seit nem Jahr. Und die Gruppe ist sowieso eingeschlafen, da kam eh keiner mehr hin.“ Die Therapeutin sieht er regelmäßig, gerade beantragt sie eine Langzeittherapie für ihn. Ich frage ihn, ob er das Gefühl hat, dass die Therapie ihm hilft. „Die Therapie … joa.“ – „Nicht so?“ – „Also ich muss letztendlich alles selber machen. Aber es hilft schon, wenn man ne Therapeutin im Hintergrund hat, mit der man reden kann, die auch neutral ist, das hilft schon, ja.“ – „Hast du denn sonst im Umfeld auch das Gefühl, dass du Menschen hast, mit denen du offen über Probleme und so sprechen kannst?“ – „Ja, mit Freunden kann ich gut reden.“ Ich frage X nach dem Kontakt und Verhältnis zu seiner Mutter. „Ja, wir telefonieren so im Schnitt so zwei, drei Mal die Woche, so für zwanzig Minuten, tauschen einfach News aus. Ja, das war’s eigentlich. Und besuchen tu ich sie so drei, vier Mal im Jahr, für ne Woche immer.“ Auch sie hat sich in Deutschland wieder gut eingefunden und ist zurückgegangen an den Ort, in dem X früher in den Kindergarten ging.


Das nächste Foto, das ich zwischen uns lege, zeigt sein Studierendenwohnheim, den Blick von seinem Fenster aus. Wie gefällt es ihm, dort zu wohnen? „Nicht so gut. Also das Wohnheim ist modern. Ich hab auch zum Glück ein Einzelappartement. Aber ich hab am Anfang mit zwei Typen gewohnt, einer kam aus Ägypten, einer aus … Libanon glaub ich. Auf jeden Fall waren die beiden religiös. Da kommen wir wieder auf das Homophobie-Thema zurück. Ich musste sie nicht fragen, ob sie homophob sind, ich weiß es einfach, weil ich halt mit solchen Leuten aufgewachsen bin. Und ich hatte halt kein Bock, irgendwie mich unangenehm zu fühlen, wenn ich mal irgendwie nen Freund hätte und den mit nach Hause bringe oder irgendetwas. Deshalb wollt ich da unbedingt raus. Und ich hab so lange gemeckert, bis ich zwei Monate später ein Einzelappartement bekommen haben, wo ich jetzt schon seit über drei Semestern wohne.“
Wir reden weiter über Xs Leben und seine Erfahrungen in Tunesien und ich frage ihn, wie sein Freundeskreis dort aussah. „In Tunesien hatte ich eigentlich kaum Freunde, ehrlich gesagt. Ich hatte immer nur son paar. Also in der Schule – das war je nach Schuljahr, weil die Klassen immer gemischt wurden – in manchen Schuljahren hatte ich mehr Leute, mit denen ich klargekommen bin, in manchen eher nicht. Also privat hab ich eigentlich kaum Leute getroffen.“ Er fährt fort: „Mein Alltag in Tunesien war sehr unspektakulär. Ich bin zur Schule gegangen, wir haben sehr lange Schultage, von acht bis sechs, mit Mittagspause dazwischen. Ja, ich hatte halt Schule, Sprachschule, zum Sport bin ich manchmal gegangen. Als ich Kind war, hab ich noch sehr viel mit Leuten auf der Straße gespielt, das ist da sehr üblich. Als ich älter wurde, so ab 14, 15 hab ich mich eher isoliert.“ – „Kannst du sagen, woran das lag?“, frage ich. „Also ich hab mich mit Mädchen sehr viel besser angefreundet als mit Jungs in Tunesien. Weil da war auch so toxische Männlichkeit irgendwie, und ich bin gar nicht son Typ. Ich hab mich mehr mit Mädchen angefreundet, aber in Tunesien ist es nicht wirklich üblich, dass ein Mädchen mit nem Jungen was unternimmt so. Deshalb – das lag wahrscheinlich auch daran. Es gab ab und zu Jungs, mit denen ich mich gut verstanden hab, aber eher selten.“
Ich spreche ihn auf seine Schüchternheit an, die er anfangs erwähnt hat und frage ihn, ob das etwas ist, was ihn immer schon begleitet hat. „Ja, das war immer so. Ich hab auch immer Angst, Leute anzusprechen. Das ist ganz schlimm bei mir“, er lacht leise. „Ich brauch einen Grund, um jemanden anzusprechen. Also ich sprech auch im Club keinen an oder so. Ganz schlimm.“ Er fährt fort: „Wenn ich jetzt irgendwie sag, ich lern jetzt auf ner Party Leute kennen, das ist für mich – das kann ich gar nicht. Obwohl ich das – das ist bei meiner Therapie immer wieder Thema, wie ich das beseitigen kann, aber ich hab’s noch nicht geschafft.“ Ich frage ihn, welche Strategien er dazu bereits gelernt hat. „Also letztendlich sagt meine Therapeutin, man muss dieses Gefühl der Ablehnung ertragen. Man muss da durch, durch diese Angst. Aber man muss es halt so oft wiederholen, bis es weniger wird.“ Er erzählt: „Ich war letztens mit zwei Freunden im Club und ich stand zwei Stunden dort und hab mich darüber aufgeregt, dass ich mich nicht trau, irgendwen anzusprechen.“ – „Aber passiert dir das dann andersherum, dass dich jemand anspricht?“ – „Nö“, einen kurzen Moment hält er inne, dann korrigiert er sich: „Also, jetzt sag ich wieder ‚Nö‘, meine Therapeutin hätte gesagt: ‚Was?!‘ Ja, mich hat mal jemand angesprochen, aber der war nicht mein Typ, da bringt mir das jetzt auch nichts“, wir lachen beide. Ich frage ihn, ob er denn bereits kleine Entwicklungen auf seinem Weg sieht. „Jein.“ Einen Moment lang ist er still. Vieles falle ihm immer noch schwer, erzählt er, aber manchmal traut er sich kleine Versuche. „Auf der Straße letztens sind zwei Leute vorbeigegangen, da hab ich ‚Hi!‘ gesagt, die haben auch ‚Hi!‘ gesagt. Das hab ich zum Beispiel gemacht. Ich hab mal jemandem meine Nummer zugesteckt, was ich mich nie getraut hätte. Das war’s schon.“

Ich blättere weiter; das nächste Bild zeigt das Foyer einer Jugendherberge. Hier war X bei einem Einführungsseminar von dem Begabtenförderungswerk, das ihn mit einem Stipendium unterstützt. Neben der monatlichen finanziellen Förderung bietet sein Stipendiengeber auch politische Seminare, Sprachakademien im Ausland oder Projektförderungen an – Dinge, die X grundsätzlich interessant findet. Bis jetzt hat er jedoch noch nicht viel in Anspruch genommen, da er nicht so viel Zeit hat, erzählt er. Neben der Uni, seinen verschiedenen sozialen Kontakten und den Gruppen, in denen er aktiv ist, engagiert X sich auch hochschulpolitisch. Nachdem er bei einer Demo einige Mitglieder der Grünen Hochschulgruppe kennengelernt hat, ist er seit letztem Winter im Studierendenparlament. Er sitzt im Härtefallausschuss und stimmt dort – mittlerweile wieder in Präsenz – über Härtefallanträge ab. Bei den Sitzungen im Studierendenparlament kommen deutlich mehr Menschen zusammen als in den Ausschusstreffen. Auch hier sieht er sich mit seiner Schüchternheit und seinen Ängsten konfrontiert. „Also in den StuPa-Sitzungen trau ich mich nicht zu reden, ehrlich gesagt. Bis heute nicht. Ich bin eigentlich eher überflüssig, glaub ich, ich stimm immer nur ab. Aber zu reden trau ich mich nicht.“ Gibt es Dinge, die er gerne tun würde in seinem Leben, aber aus diesen Gründen nicht macht? Er überlegt lange. „Also … ich wäre gerne Politiker“, er lacht. „Aber das würde ich mich nicht trauen. Also da müsste ich ja durch diesen ganzen Dschungel durch, und das kann ich halt nicht.“ Ich frage, welche Themen ihm politisch wichtig sind. „LGBT-Sachen und sozialdemokratische Sachen so, was vor allem Geld angeht. Das ist mir wichtig.“ – „Weißt du, woher das kommt, dass dir das Thema wichtig ist?“, frage ich nach. „Also LGBT ist obvious, glaub ich. Der Rest ist so – also ich bin ja nach Deutschland gekommen, ich hab immer Bafög bekommen. In Tunesien gibt’s sowas gar nicht. Und so Finanzsachen interessieren mich irgendwie von Grund auf. Und ich bin jemand, der alles hinterfragt. Ich hinterfrage, wie Krankenkassen das abrechnen, ich hinterfrage, wie nen Bafög-Antrag berechnet wird, hab mir auch das Gesetz durchgelesen. Und ich find das halt irgendwie spannend.“ – „Und ist es eher der systemische Teil, der dich daran interessiert, oder auch so Ungerechtigkeiten oder sowas?“ – „Beides!“ Wir reden darüber, welcher Partei er sich nahe fühlt. „Ich überlege, zur SPD-Hochschulgruppe zu wechseln, weil die Grünen sind nicht so meins, weil ich liebe Flugzeuge. Ich bin ein absoluter Flugzeugfan. Und ich liebe es, zu fliegen.“ – „Das ist so der Hauptpunkt?“ – „Ja, und … von den Sachen, die mir wichtig sind und die ich dir genannt hab, hab ich jetzt nicht Umwelt genannt. Weil ich meine, ich kann mich nicht um alles kümmern. Umweltthemen sind jetzt nicht mein – es interessiert mich einfach nicht.“ Mittlerweile ist es heiß geworden, obwohl wir im Schatten sitzen. Die Frau links von uns ist schon längst weg, auch die jungen Männer.
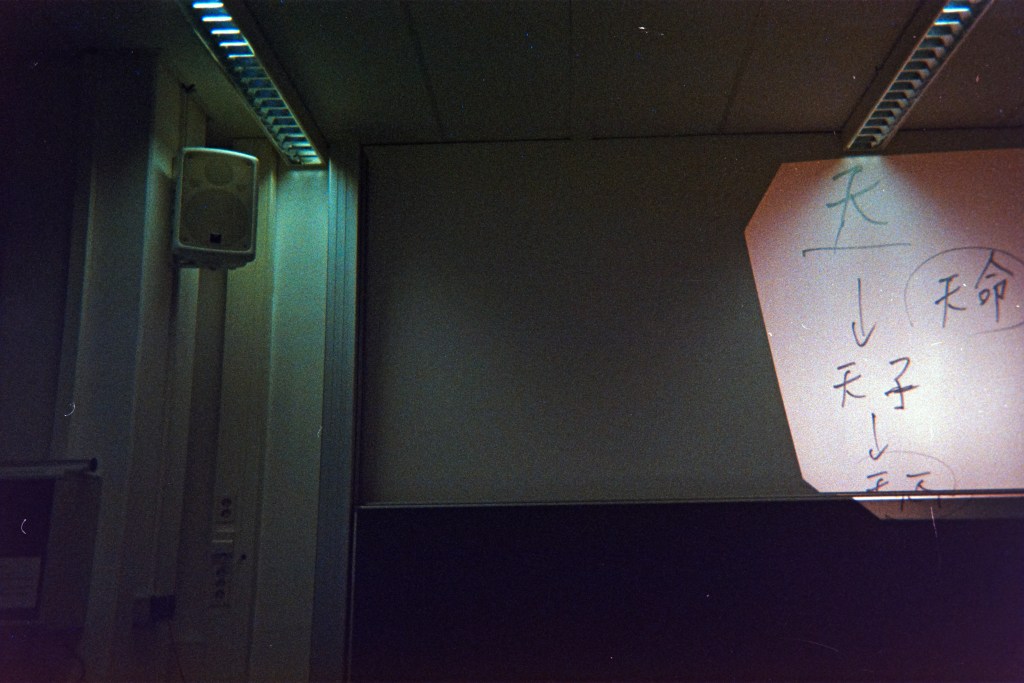
Ich lege das nächste Bild zwischen uns: es zeigt die Uni-Cafeteria. Nach den Veranstaltungen ist X hier oft mit seinen Kommiliton:innen, zum Essen, zum Quatschen. „Bist du gerne an der Uni?“, frage ich ihn. „Ja, ich liebe Studieren. Ich bin auch gerne im Hörsaal und so. Ja, macht schon Spaß.“ Das nächste Foto zeigt den Hörsaal. „Das ist eigentlich mein Lieblingsbild“, sagt X. „Das war empirische Wirtschaftsforschung, das war mein Lieblingsfach dieses Semester.“ Ich frage, ob er schon weiß, was er nach dem Bachelor machen möchte. Auf jeden Fall einen Master; welchen, weiß er aber noch nicht. Wenn er fertig ist mit seinem Studium, möchte X gerne wegziehen aus dem Ruhrgebiet. „Ich weiß nicht, Ruhrgebiet – das klingt wie gesagt voll rassistisch, aber es ist so homophob. Also, ich fühl mich halt einfach nicht wohl. Ich kann ja auch nichts dafür, was ich fühle.“ Er fährt fort: „So große Städte wie Berlin oder Köln sind auch nicht immer das Beste, weil’s da auch so Ecken gibt, die son bisschen homophob sind. Aber so Städte wie Tübingen, oder am Bodensee oder Kiel oder ich weiß nicht…“ – „Also wär dir da einfach am wichtigsten, dass du dich da sicher fühlen kannst?“, frage ich. „Ja, das wär mir am wichtigsten. Und ich muss halt auch gucken, wo ich beruflich irgendwie bleiben kann. Wo ich irgendne Firma finde, wo ich arbeiten kann.“


Wir blättern weiter durch die Fotos. Ein Bild aus dem Zug heraus: „Ich mag Zugfahren, deshalb hab ich so Bahnhofsachen fotografiert.“ Noch ein Bahnhofsfoto: „Ich bin sehr oft an Bahnhöfen“. X ist viel unterwegs, trifft sich mit seinen Freund:innen oft auch in anderen Städten. Das nächste Bild zeigt das Haus, in dem seine Oma wohnt, in einem Dorf an der holländischen Grenze, in der Gegend, aus der auch seine Mutter ursprünglich kommt. „Ich mag diese Dörfer, ich find die schön. So richtig deutsch.“ Ungefähr alle zwei Monate, ist er hier, besucht seine Oma. Auch als er noch in Tunesien gelebt hat, hatten sie regelmäßig Kontakt. „Immer Telefon, Telefon, Telefon. Besuch war eher so alle paar Jahre.“ Zwei Mal war sie in Tunesien zu Besuch. „Warst du in der Zeit eigentlich auch mal in Deutschland?“, frage ich. „Also ich bin ja 2008 nach Tunesien gezogen. Bis 2010 war ich noch zwei Mal im Jahr in Deutschland, da hat es sich noch gar nicht so angefühlt, als ob ich da wohnen würde, weil ich so oft noch hier war, weil meine Mum erst 2010 gekommen ist. Dann war ich 2010 einmal in Deutschland und dann 2015 erst wieder. Weil meine Eltern immer blank waren, haben die das nicht managen können. Dann 2017 war ich zwei Mal in Deutschland. Und dann bin ich ja hergezogen.“ Ich frage ihn, wie es war, anfangs allein mit seinem Vater in Tunesien zu leben. „Ich hab meine Mum oft vermisst und geweint. Papa, typischer Tunesier: ‚Ja, stell dich nicht so an, sei doch ein Mann‘ und so. Also, er hat das nicht aktiv gesagt, aber ich wusste, dass das seine Einstellung war. Sonst war’s eigentlich ganz okay.“ Ich frage nach, warum sein Vater und er allein, ohne die Mutter, vorgegangen sind. „Weil meine Mum auch noch gearbeitet hat und Papa – wir hatten in Tunesien ein Haus gebaut – Papa das überwacht hat und so. Mama hat halt noch gearbeitet.“ Seine Mutter hat – wie X nun – Wirtschaft studiert und damals in diesem Bereich gearbeitet. In Tunesien arbeitete sie als Sprachlehrerin. „Was hat dein Papa gearbeitet?“ – „Der hat so hin und her – der hatte mal ein Café gehabt, Taxi hat er gehabt, also nicht selber gefahren. Ja, das hat der so gemacht.“ Ich frage X, ob er es als schwierig empfunden hat, wie seine Eltern gelebt und gearbeitet haben. „Ja, ich hab das als instabil wahrgenommen.“ – „Hat dich das gestresst als Kind?“ Er überlegt. „Ne, als Kind nicht. Eher als Jugendlicher, weil man das mehr wahrnimmt.“ Über sein eigenes Leben hat er Kontrolle, ist strukturierter. „Ich mag auch, zu wissen, was in der Zukunft ist. Ich mags, wenn ich weiß, was passiert.“

Ich blättere weiter. Das nächste Bild ist an dem Bahnhof entstanden, an dem seine Oma ihn absetzt, wenn er zurück ins Ruhrgebiet fährt. „Ich find’s idyllisch. Ich mag diese Häuser, ich mag diese Stille dort. Aber ich würd trotzdem nicht hinziehen.“ Das Haus, in dem sie damals in Tunesien gelebt haben, ist schon lange in anderem Besitz. „Wir haben immer Häuser gekauft und verkauft, gekauft und verkauft.“ Ich frage X, ob er sich an neuen Orten schnell zuhause fühlen kann. „Das hängt sehr davon ab, ob ich Leute kennenlerne, die an dem Ort wohnen, oder nicht“, erklärt er. „Wenn ich einsam in meinem Zimmer verrecke, bringt mir das auch nichts, egal wie schön es ist.“
Zurück zu allen Werken

Hinterlasse eine Antwort zu Projekt „Perspektive(n): Mensch“: Von Alltag und Schicksalsschlägen – Akduell Antwort abbrechen